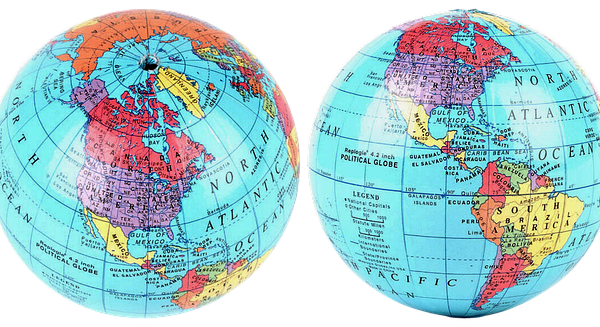Ob man nun Maker-Kultur, DIY-Experten oder Innovative Citizen sagt – im Grunde bezeichnen alle Begriffe den gleichen Typus von Bürger. Und dieser Bürger möchte nicht länger nur im stillem Kämmerlein vor sich hinwerkeln sondern möchte mit seinem Werken und Wirken die Stadt positiv zum Besseren verändern. Wie die Urbanisten in Dortmund etwa oder Duistopia in Duisburg. Auf diesen neuen Typus von Bürger sind Städte aber momentan gar nicht vorbereitet.
Eine Stadt ist ein kompliziertes Gebilde, ein Geflecht aus unterschiedlichen Interessen, Anliegen, Regeln und Absichten. Und Städte sind an ein traditionelles System gewöhnt: Wenn man den Bürger mit einbeziehen möchte, so bietet man Bürgersprechstunden an – wo der Bürger meistens einem Politiker gegenübersitzt und es den Anschein hat als würde man sich um einzelne Probleme kümmern, ob man es dann auch tut ist die Frage. Oder man macht einen Bürgerbeteiligungsprozess: In vorgeschriebenen Panels dürfen Bürger diskutieren, Anregungen einreichen, Ratschläge abgeben. In Duisburg wird momentan ein Image auf diesem Wege gesucht – ob das der richtige Weg ist, das bleibt die Frage.
Der selbstbewußte Bürger
All diese traditionellen Wege setzen jedoch ein Verständnis des Bürgers voraus, das nicht mehr zeitgemäß ist. Jedenfalls für einen Teil der Bürgerschaft der Stadt nicht mehr. Denn die innovatigen und jungen Ideen der Bürger entstehen in der Regel nicht durch die Gängelung und vorgegebene Führung von Städten und der Verwaltung, sie entstehen spontan und ihre Durchführung wäre meistens mit der vorgeschriebenen Anzahl der Wege – diverse Behörden müssen zu diversen Dingen ja ihre Zustimmung geben – nicht vereinbar. Wenn der Ludgeriplatz in Duisburg neu gestaltet wird passiert dies durch eine „aktive Nachbarschaft“. In diesem Fall hat wenigstens der Kulturbeirat der Stadt etwas Unterstützung geliefert und die Stadt hat sich bei den Genehmigungen auch nicht gesträubt. Jedoch ist dies nicht immer der Fall. Vor allem dann nicht, wenn Bürger gar nicht einsehen warum sie für eine Aktion in einem öffentlichen Raum – Stadtpark etwa – nun eine Genehmigung für etwas brauchen. Und diese dann nicht besorgen sondern einfach machen.
Städte sind momentan etwas hilflos, geht es um diese neue Art von Bürgern. Die Maker-Kultur, die Menschen ermutigt selbst tätig zu werden – Repair-Cafes – Fab-Labs – all diese Dinge brauchen Orte, an denen die Bürger zur Ermöglichung berufen sind. Wenn es einen Coworking-Space in der Stadt gibt, werden sich sicherlich einige dort versammeln, aber die eigentliche Keimzelle für die Entwicklung der Stadt durch Creative Citizens müsste so etwas wie die Stadtbibliothek, Künstlerhäuser der Stadt oder andere Orte sein.
Agilität gegen Stabilität
Allein: Die nötigen Räume zu schaffen, damit tut sich die Stadt schwer und ihre Argumentation lautet, dies sei keine städtische Aufgabe sondern Sache der örtlichen Kultur vor Ort. Was etwas kurzsichtig ist: Kultur sorgt für einen nicht unbedeutenden Wirtschaftsfaktor, wobei die Spill-Over-Effekte für Deutschland noch nicht so erforscht sind. Schade eigentlich, der Kultur fehlen ja meistens handfeste Argumente, warum sie wichtig ist.
Jedenfalls ist die Stadt auch in der Verantwortung, wenn es darum geht die Bestrebungen derer zu fördern, die selbstbewusst als Bürger auftreten und machen möchten. Die Agilität jedoch mit der diese vorgehen ist konträr zu der Stabilität des Verwaltungsapparates – manchmal ist die Genehmigung erteilt, wenn die Initiative schon längst vollzogen wurde oder sich aufgelöst hat. Dieses Ungleichgewicht führt zu einer Unzufriedenheit bei den Makern. Einerseits möchten sie wirklich die Stadt verbessern, möchten Probleme vor der eigenen Haustür angehen – andererseits werden sie durch das Regelwerk der Verwaltungen ausgebremst und verlangsamt. Dass es Regeln für das Zusammenleben geben muss und dem Recht entsprochen wird – keine Frage. Es geht ja sonst nicht anders. Doch scheint in der Verwaltung der Stadt des öfteren das Fingerspitzengefühl im Umgang mit den neuen Bürgern verlorgen gegangen zu sein.
Verständnis und Vertrauen der Anfang von allem
Vertrauen ist der Anfang von allem sagt die Werbung. Und da hat sie ausnahmsweise Recht: Wo Misstrauen und Zwietracht herrschen wird so schnell nichts Gutes gedeihen können. Daher ist es wichtig und richtig, dass die Akteure sich einander begegnend kennenlernen, in den Dialog kommen, verständlich machen wo die Probleme sind. Noch wichtiger aber auch: Gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Zuhören. Verständnis zeigen. Auch von der Seite derer, die auf die Verwaltung schimpfen, denn manchmal kann die Verwaltung nicht anders handeln. Vielleicht sollte man ein Barcamp veranstalten. Oder eines dieser Panels. Dann aber wirklich mit dem Vorsatz zuzuhören.